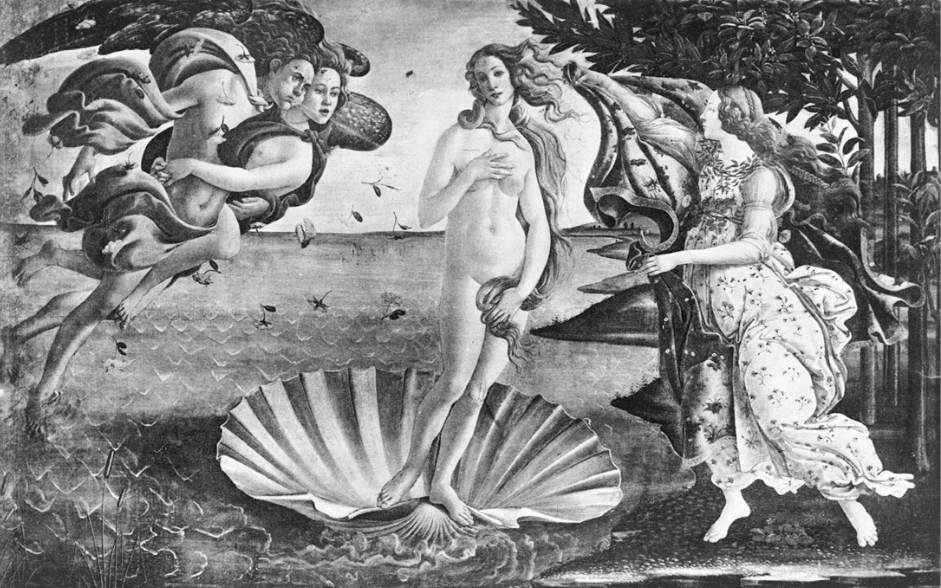Gerhard Fischer
Ein roter Rubin im Diadem der Moderne
Aby Warburgs Bilderatlas Mnemosyne
Notwendig ist alles Seiende entweder grenzend oder unbegrenzt oder grenzend wie auch unbegrenzt. Aber
allein unbegrenzt oder allein grenzend kann es nicht sein. Da nun also das Seiende weder alles aus
Grenzendem noch alles aus Unbegrenztem entborgen scheint, ist offenbar, dass sowohl der Kosmos wie alles,
was in ihm istz, aus Grenzendem und Unbegrenztem zusammengefügt ist.
PHILOLAOS
I
Mnemosyne, eine Titanin, schlief laut griechischer Überlieferung neun Tage lang mit Zeus und gebahr ihm dafür die
neun Musen . Für Warburg war die Riesendame mit dem
zungenbrecherischen Namen die Schutzpatronin seiner Suche. Unter ihrem Namen, der Erinnerung bedeutet, und die
Künste als Kinder des Gedächtnisses nobilitiert, gedachte Warburg ein Bild-Werk zu veröffentlichen, das seine
Forschungen wie in einem Brennglas bündeln sollte.
Am Penelopefaden der Erinnerung haben viele gesponnen: Unvergleichlich schön und erhaben hat das der
Griechendichter Friedrich Hölderlin getan, von dem Bettina von Arnim berichtet, „dass er Stunden lang beim
Gemurmel eines Bachs griechische Oden hersagte“. In pflanzenhafter Schrift und mit fast tintenleerer Feder
schrieb Hölderlin im Juli 1803 den fünfstrophigen Doppelgesang „Mnemosyne/ Die Nymphe“:
Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet
Die Frücht und auf der Erde geprüfet und ein Gesetz ist,
Daß alles hineingeht, Schlangen gleich,
Prophetisch, träumend auf
Den Hügeln des Himmels. Und vieles
Wie auf den Schultern eine
Last von Scheitern ist
Zu behalten. Aber bös sind
Die Pfade. Nämlich unrecht
Wie Rosse, gehn die gefangenen
Element und alten
Gesetze der Erd. Und immer
Ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht. Vieles aber ist
Zu behalten. Und not die Treue.
Vorwärts aber und rückwärts wollen wir
Nicht sehn. Uns wiegen lassen, wie
Auf schwankem Kahne der See.
Wie aber Liebes? Sonnenschein
Am Boden sehen wir und trockenen Staub
Und heimatlich die Schatten der Wälder und es blühet
An Dächern der Rauch, bei alter Krone
Der Türme, friedsam; gut sind nämlich,
Hat gegenredend die Seele
Ein Himmlisches verwundet, die Tageszeichen.
Denn Schnee, wie Maienblumen
Das Edelmütige, wo
Es seie, bedeutend, glänzend auf
Der grünen Wiese
Der Alpen, hälftig, da, vom Kreuze redend, das
Gesetzt ist unterwegs einmal
Gestorbenen, auf hoher Straß
Ein Wandersmann geht zornig,
Fern ahnend mit
Dem andern, aber was ist dies?
Am Feigenbaum ist mein
Achilles mir gestorben,
Und Ajax liegt
An den Grotten der See,
An Bächen, benachbart dem Skamandros (...)
Patroklos aber in des Königs Harnisch. Und es starben
Noch andere viel. Am Kithäron aber lag
Elevtherä, der Mnemosyne Stadt. Der auch als
Ablegte den Mantel Gott, das abendliche nachher löste
Die Loken. Himmlische nemlich sind
Unwillig, wenn einer nicht die Seele schonend sich
Zusammengenommen, aber er muß doch; dem
Gleich fehlet die Trauer.
Wir zögern lange vor diesen exemplarischen Strophen, wir gewöhnen uns nur langsam an den Drahtseilakt des
Dichters, der einen arkadischen Zustand zu imaginieren versucht. Deshalb kann man diese Dichtung unter die
extremsten Künste reihen – wer sich darin ausdrückt ist ein sonderbares, unzeitgemäßes, abweichendes und man
könnte sagen: entrücktes Subjekt.
Und da ist noch ein Schriftsteller, Marcel Proust genannt, der in die Erinnerungsarbeit mit dem Jahrhundertroman
„Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ getaucht ist. Ein solches Werk, dass die Zeit zum Subjekt hat, geht von
einem Seelenzustand und seinen Assoziationsketten zu einem schöpferischen oder transzendenten Sehpunkt über. Ein
schräger Strahl des Sonnenuntergangs, ein Geruch, ein Geschmack, ein Luftstrom, verdanken ihren Wert allein der
subjektiven Seite, in die sie eindringen.
Prousts großes Werk wird im Sommer 1909 in Paris in Angriff genommen und damit beginnt ein hartnäckiger Wettlauf
gegen den Tod, der die Vollendung des Buches gefährdet hat, bekanntlich war Proust asthmakrank und man merkt es
der „Recherche du temps perdu“ an, dass sie aus den stockenden Atemzügen des Autors ihr ästhetisches Kapital
schlägt .
Der erste Satz der „Recherche“ eröffnet eine etwa fünfzig Seiten lange Episode. Wovon spricht diese Episode? Vom
Schlaf. Der Proustsche Schlaf besitzt stiftenden Wert; es handelt sich um einen Schlaf, der geschrieben werden
kann: „Ich habe versucht, mein erstes Kapitel in die Eindrücke des Halbwachseins zu hüllen“, äußerte Proust, und
weiter lesen wir: „Im Schlaf versammelt der Mensch um sich im Kreis den Lauf der Stunden, die Ordnung der Jahre
und der Welten... doch können ihre Ordnung durcheinandergeraten, sie können zusammenbrechen“. Es geht darum, die Schleusen der Zeit zu öffnen, den
logischen Panzer der Zeit anzugreifen, es gibt keine Chrono-logie mehr (wenn wir denn die beiden Teile des
Wortes trennen wollen).
Natürlich kann eine derartige Revolution der Logik nur eine dumme Reaktion auslösen: Alfred Humblot, Lektor im
Verlag Ollendorf, erklärte nach Erhalt des Manuskriptes „Du côté de chez Swann“ („Unterwegs zu Swann“): „Ich
weiß nicht, ob ich ein Brett vor dem Kopf habe, aber ich begreife nicht, welchen Zweck es haben soll, dreißig
Seiten darüber zu lesen, wie sich ein Herr in seinem Bett wälzt , bevor er einschläft.“
Der Literatursemiologe Roland Barthes sprach von der rhapsodischen Struktur der „Recherche“, das heißt
(etymologisch) zusammengenäht, übrigens eine Proustsche Metapher. Das literarische Werk wird wie ein Kleid angef
Die Schlußfolgerungen, zu denen Warburg in diesem Text aus dem Jahre 1893 gelangt, sind bemerkenswert, nimmt er
doch sieben Jahre vor der Freudschen „Traumdeutung“ das Paradigma des Traums als eigenständige
Interpretationsachse vorweg. Warburg bietet den Traum nicht als Deutungsinhalt an, sondern als einen Appell zur
Deutung. Walter Benjamin wird dreißig Jahre später das Bild in einer „Dialektik im Stillstand“ erfassen. Wie Marcel Proust in der „Recherche“ mit
einer Darstellung des Raums des Erwachenden beginnt, greift Benjamin das Erwachen als dialektische Bruchstelle
im höchsten Grade auf: „Sollte Erwachen die Synthese sein aus der Thesis des Traumbewußtseins und der Antithesis
des Wachbewußtseins? Dann wäre der Moment des Erwachens identisch mit dem ‚Jetzt der Erkennbarkeit’, in dem die
Dinge ihre wahre surrealistische Miene aufsetzen (...)“
Das dem Schlaf entsprungene Werk beruht auf einem provozierenden Prinzip: Der Desorganisation der Zeit (der
Chronologie). Dies ist nun ein sehr modernes Prinzip .
II
Die Zeit, als das neunzehnte Jahrhundert ins zwanzigste kippte, ist die Zeit Warburgs. In Wien am Alsergrund,
Berggasse 19, wagte sich Sigmund Freud in die Tiefen des Unbewußten und deutete die Träume; hoch in den Bergen,
nahe dem Schnee, nahe dem Adler prophezeite Friedrich Nietzsche: „Man muß das All zersplittern, den Respekt vor
dem All verlernen“. Tausend Meter unter dem Meeresspiegel und auf dem Mond tauchte Jules Verne auf, Bühnenzauber
und echte Magie erblühten im Gaslicht des neunzehnten Jahrhunderts und es ereigneten sich zu Hauf sexuelle
Peitschenspielchen in den Stallungen der Superreichen und schmuddelige Orgien in den stickigen Quartieren des
Lumpenproletariats.
Die gerichtete, beschleunigte Zeit hatte sich in der Moderne flächenmäßig über den gesamten Gesellschaftskörper
ausgebreitet. Aaeroplan, Eisenbahn, Automobil, Telefon, Radio und Grammophon spielen extensive Rollen. Siegfried
Kracauers „Schriften zur Massenkultur“ bezeugten, das „Tohuwabohu verdinglichter Seelen“. Die futuristischen
Apparate der modernen Zeit hat der Bauhauskünstler Otto Umbehr in der Montage „Der rasende Reporter“ im Jahre
1926 ins Blickfeld gerückt, das Maschinenlabor explodiert und man hat nie zuvor die Inkunablen der
Geschwindigkeit so fokussiert gesehen wie auf diesem Bild.
Es ist ein drangvolles Durcheinander. „Sonnenfinsternis“ (1926) betitelt George Grosz eines seiner Gemälde. Die
Sympathie des Malers gehört über weite Strecken Aufrührern, denen die Despotie der Kapitalisten nicht weniger
barbarisch vorkommt als die russische Autokratie. Die zahme deutsche Arbeiterbewegung jener Jahre bleibt ein
geeigneter Stoff für reizvolle Literatur wie sie der Mann mit der Zigarre und Lederjacke, genannt Bertolt
Brecht, geschrieben hat. Thomas Pynchon hingegen ist die amerikanische anarchistische Arbeiterbewegung eine
große Totenklage wert, sein Roman „Against the Day“ verleitet mit Dynamit und Kunst zum Aufruhr.
In diesen Brennpunkten ereignen sich die vorerst tastenden, dann galoppierenden Denk-und Bildbewegungen eines
verwegenen jüdischen Gelehrtenkreises, der in Hamburg residierte.
Die Geschichte des Warburg- Instituts war von Anfang an ein wenig abenteuerlich. Sein Begründer Aby Moritz
Warburg, im Jahre 1866 in Hamburg geboren, war der älteste Sohn einer Bankiersfamilie, die auf eine
hundertjährige Tradition zurückblickte, er weigerte sich in die Firma einzutreten, nachdem er mit achtzehn
Jahren beschlossen hatte, das kontemplative Dasein eines Gelehrten zu führen und sich dem Studium der
Kunstgeschichte und Archäologie zu widmen.
Warburg studierte in Bonn und in Strassburg. Die Briefe, die Warburg in der Bonner Zeit an seine Mutter Charlotte
Warburg schrieb, sind aufschlußreich, zeigen sie doch die bourgeoise Stofflichkeit seiner Existenz. „Aby hielt
auf Form, sah immer gut aus – mengte sich nicht unter das Volk“, heißt es schon über das Kind . Sein Taschengeld für das Studium ist ihm zu gering, „er
sei zur blutigsten Sparsamkeit gezwungen“, er verwende „nur noch spitze Federn, um weniger Dinte zu
gebrauchen.“ Er dankt für eingetroffene Eßwaren und
Weinflaschen erster Güte, zuzüglich Zigarren sonder Zahl, Bier und Sekt fließt in Strömen bei Feiern mit
Kommilitonen, Kegel- oder Billardspiele wechseln mit Skatpartien. Morgens frequentiert er den Barbier zum
Rasieren und Frisieren, nachmittags den Fechtmeister und da ist der rheinische Karneval, dessen erotisches Flair
er zu genießen versteht. Im Brief vom 23.2. 1887 blitzt Erogenität auf. Folgen wir einigen flackernden Zeilen:
„(...) Sonntag waren wir... in Köln und zwar als 5 Schornsteinfeger, die zusammen an einer zusammenlegbaren
Leiter herumschleppten und exercierten; wir sahen sehr komisch aus: ganz schwarz, bis über den Kopf durch die
Kapuze verhüllt, nach der Größe sortiert,...mit weißen Glaces und Halbmaske...Wenn hübsche Mädchen am Fenster in
der I. Etage waren, stellten wir unsere Leiter zusammen, ich stieg hinauf und machte meine Referenz natürlich
unter kolossalem Halloh der Menschenmenge (...)“.
Die Volksmasse wird den Einzelgänger Warburg immer wieder anlocken wie sein Spätwerk eindringlich vor Augen
führt. Die scheinbar unausrottbare Bildungsfeindlichkeit der Unterschicht will Warburg aufbrechen, er bastelt
fleißig an Bildersammlungen im volkstümlichen Ton, nie die Gebote der Aufklärung außer Acht lassend. So
beabsichtigt der Dreiundsechszigjährige im Jahre 1929 den Wasserturm im Stadtpark von Hamburg zum Planetarium
auszubauen und hier eine Dauerausstellung einzurichten. Er konzipiert einen Bildpfad durch den Weltraum und gibt
diesem den Titel „Bildersammlung zur Geschichte von Sternglaube und Sternkunde“.
III
Im Florenz der Renaissance wird der Kunststudent Aby
Warburg im Jahre 1888 ein „großes helles 3 fenstriges Zimmer nach Süden, mit wunderbarer Aussicht“ beziehen. Er
beklagt den „widerlichen Südwind“, da dieser eine „erschlaffende süße Luft“ mitsichbringe . Und doch wird Warburg über die Maler der zweiten
Hälfte des Quattrocento, die in ihren Bildwerken das Spiel der Lüfte und Winde einkapselten, intensive Studien
anstellen.
Wir denken an Sandro Botticellis Gemälde „Die Geburt der Venus“ (1484-86). Wir sehen Venus wie sie in einer
Muschel über das Meer von Zephyrwinden ans Ufer getrieben wird: „(...) Darin in lichter Duftgestalt erwächst Ein
Mädchen nicht wie Menschen anzusehn. Auf einer Muschel treiben es, dem Himmel Zur Wonne, weiche Weste ans
Gestade. 100 Du nenntest wahr den Schaum und wahr das Meer Und wahr die Muschel, wahr das Wehn der Winde. Das
Leuchten sähst du in der Göttin Augen, Den Himmel lächeln rings, die Elemente, Den Sand mit weißem Tuch die
Horen decken, Die Luft die losen, weichen Haare kräuseln“ so beschrieb der Humanist Angelo Poliziano im Jahre
1494 in den Stanze per la giostra“ die Aphrodite Anadyomene“, und variiert Hesiods Schöpfungsmythos, der seinem Text zugrunde liegt.
Da Poliziano den Westwinden das Attribut lasziv („zefiri lascivi“) zuschreibt, gestatten wir uns an diesem Punkt
eine kleine Abschweifung in die griechische Mythologie, und nehmen wir eine Spurensicherung der seit dem Zweiten
Jahrtausend bezeugten Windkulte vor. Venti sind dämonisierte Verkörperungen von Winden, seien es Brisen, Stürme
oder Wirbelwinde. Venti sind Bewegungen der Luft, charakteristisch ist die Stimme (man hört sie) und die
Schnelligkeit, weshalb man sie geflügelt oder als Flügelpferde darstellte. Venti werden von Göttern entfesselt
oder besänftigt. Homeros beschreibt Zeus als „Wolkensammler“ und Regengott, der Aiolos beauftragte „Walter der
Winde zu sein (Hom. Od.10, 21). Ausserhalb des Mythos deuten Venti kosmologisch Zeit und Raum an. Die am „Turm
der Winde“ in Athen in Stein dargestellten vier Haupt-
und vier Zwischen-Winde sind mit Beischrift versehen. Erstere heißen dort Boreas (Nordwind oder „König der
Winde“ (Pind. P. 4, 181), der Finsternis, Kälte und Schnee bringt), Apeliotes (Ostwind), Notos (Südwind),
Zephyros (Westwind), letztere Kaikias (Nordostwind), Euros (Südostwind), Lips (Südwestwind), Skiron
(Nordwestwind). Diese Namen sind großenteils panhellenisch, für lateinische Äquivalente ist Plinius nat.2 ,
119-121 wichtig. Die bekanntesten mythologischen Venti sind Boreas und Zephyros, zu denen Achilleus betet, den
Scheiterhaufen des Patroklos zum Brennen zu bringen (Hom. Il.23, 193-197). Darauf geht Iris als Botin zu den
Venti, die im Haus des Zephyros schmausen. Hesiod nennt Boreas, Notos und Zephyros als Söhne des Astraios und
der Eos und als Brüder der Sterne, „im Äther geboren“ heißt Boreas auch bei Hom. Od. 5, 296.
Auf dem „Turm der Winde“ sind alle acht Winde in der Richtung, aus der sie blasen nach rechts schwebend,
unterhalb des Gesimses angebracht, die Venti sind fast alle bekleidet bis auf den Frühlingswind Zephyros, um
dessen Nacktheit ein wehendes Gewand voller Blumen drapiert ist. Zephyros durchläuft in antikem Text- und
Bildquellen zahlreiche erotische Abenteuer, nicht zuletzt die Knabenliebe zu Hyakinthos:
Der Stangenkrater des Eucharides-Malers in Ferrara und der Skyphos des Lewis-Malers in Neapel verdeutlichen
diese amour fou.
Mit Zephyros schwingt die Lust, ein rasendes Begehren. Auch auf Lesbos, Sapphos Insel, singt der Liebeszauber,
kein Grieche war darüber empört, erst Römer nannten Sappho Hure oder Lesbe. Tritt Zephyros im „Turm der Winde“
als Blüten-Ephebe in Erscheinung, wird in den Vasenmalereien des ausgehenden sechsten und beginnenden fünften
Jahrhunderts die erotische Jagd nach Hyakinthos durch einen virilen Zephyros effektvoll dargestellt-Georges
Dumézil hat den homoerotischen Bund des „erastes“ (Zephyros) mit dem „eromenes“ (Hyakinthos) in der
indogermanischen Gesellschaft als Erziehungsform offengelegt. Die wilden Energien, die in den Quellen
zirkulieren, sind in Botticellis „Venus“ wie ein leise pochender Herzschlag noch zu vernehmen – zart: Wie
Eiskristalle, hat Botticelli Rosenblätter über das ganze Bild verstreut und die Physik des Windhauches trefflich
gemalt, und er hat mit der „Geburt der Venus“ ein Lockmittel ersonnen, um die antiken Quellen, pendelnd zwischen
Eros und Thanatos, sichtbar zu machen .
Aby Warburg hat die wie in Zeitlupe angehaltenen Bilderfindungen Botticellis zum Gegenstand seiner Dissertation
gemacht, die Schlußpassage wird uns lange im Gedächtnis bleiben. „Von manchen Frauen und Jünglingen
Botticellis“, schreibt er, „möchte man sagen, sie seien eben erst aus einem Traume zum Bewußtsein der Außenwelt
erwacht, und, obgleich sie sich der Aussenwelt wieder thätig zuwenden, durchklängen noch Traumbilder ihr
Bewußtsein.“
Die Schlußfolgerungen, zu denen Warburg in diesem Text aus dem Jahre 1893 gelangt, sind bemerkenswert, nimmt er
doch sieben Jahre vor der Freudschen „Traumdeutung“ das Paradigma des Traums als eigenständige
Interpretationsachse vorweg. Warburg bietet den Traum nicht als Deutungsinhalt an, sondern als einen Appell zur
Deutung. Walter Benjamin wird dreißig Jahre später das Bild in einer „Dialektik im Stillstand“ erfassen. Wie Marcel Proust in der „Recherche“ mit
einer Darstellung des Raums des Erwachenden beginnt, greift Benjamin das Erwachen als dialektische Bruchstelle
im höchsten Grade auf: „Sollte Erwachen die Synthese sein aus der Thesis des Traumbewußtseins und der Antithesis
des Wachbewußtseins? Dann wäre der Moment des Erwachens identisch mit dem ‚Jetzt der Erkennbarkeit’, in dem die
Dinge ihre wahre surrealistische Miene aufsetzen (...)“
Zu dem stereoskopischen und dimensionalen Sehen in die Tiefenschichten eines Kunstwerks, gesellt sich Warburgs
Faszination der Androgynität, die in der Bildproduktion von Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Filippino
Lippi vor Augen tritt. Diese Bilder und ihr terrain vierge zeigen meist Darstellungen von Nymphen. Das Reich der
Nymphen: Sie halten in der Hand einen belaubten Zweig, der einen durch Berührung verwandelt oder sie tauchen in
lauwarmes Brunnenwasser unter, in dem man ertrinken kann. Aby Warburg umkreist und streift das Fliehende: Objekt
und Ende des Begehrens ist die Nymphe, der man immer auf der Spur ist ohne sie je zu erreichen.
In der feingliedrigen Kunst des Quattrocento suchte Warburg die Wiederkehr des antiken Heidentum und er machte
darauf aufmerksam, wie hoch die Kunst des Nordens bei den Italienern des fünfzehnten Jahrhunderts in Kurs stand.
Was ihn nicht minder interessierte, waren soziale und politische Wirklichkeiten, die durch symbolische
Kommunikation geprägt waren. Ritualisiertes Verhalten machte Warburg zu einem Strukturprinzip städtischen
Gemeinschaftslebens, demnach erfüllten öffentliche Rituale in Gestalt von Festzügen und Prozessionen ambivalente
Funktionen. In Warburg ist auch ein Bildhistoriker der Krisenzeit der florentinischen Republik im fünfzehnten
Jahrhundert zu entdecken.
Will man die Renaissance Ideale verstehen, muß man die kosmologischen Motivreihen - die in vielem antiken Quellen entstammen- dechiffrieren,
und man muß die zahllosen Traktate zur Autonomie des Subjekts, die im fünfzehnten und im sechzehnten Jahrhundert
veröffentlicht wurden, berücksichtigen, schon der dreiundzwanzigjährige Giovanni Pico della Mirandola sprach
1486 vom Menschen als Chamäleon und als „Bildhauer seiner selbst“. Petrarca trat mit dem bis in die Moderne
wirkungsträchtigen Text „Aufstieg auf den Mont Ventoux“ hervor, Dantes „Philosophische Schriften“ zirkulierten,
die Sprachphilosophie warf ihre Schatten voraus und
Leon Battista Alberti, „der Seiltänzer der Selbsterschaffung“ schuf ein theoretisches Oeuvre zu Kunst,
Wissenschaft und Technik, fast gänzlich bilderlos.
Albertis ikonophobischer Pfad ist der rein literarischen Beschreibung („commendare alle lettere“) verpflichtet
und steht an der Schwelle eines epochalen medienhistorischen Umbruchs: dem Buchdruck. Albertis um 1440
veröffentlichte vierseitige Schrift „Descriptio Urbis Romae“ bedurfte keiner ergänzenden Bilder oder
Zeichnungen, schon Ptolomäus verzichtete in der erstmals wieder 1409 erschienenen „Cosmographia“ auf eine
zeichnerische Darstellung der Welt, lediglich achttausend Koordinatenpaare, akribisch eingetragen, zeigen
geographische Wendepunkte an.
Wendepunkte in der Klassifikation der Welt setzte das Zeitalter der Frührenaissance gar viele, da ist auch die
Erprobung und Auslotung der Zentralperspektive nicht
zu übersehen. Mit der Methode der perspektivischen Raumdarstellung (19) simulierten Alberti und Filippo
Brunelleschi eine geordnete Welt, in der sich das moderne Subjekt orientieren, also eine Identität ausbilden
kann. Alberti bildete einen verästelten Diskurs über den Akt des Sehens aus und charakterisierte die Eigenart
des Sehens in der Gegenüberstellung von zentralem und lateralem Sehen, anders gesagt, mit der Art, in der sich
das Sichtbare für unsere Augen nicht nur in der Tiefe sondern auch in den Randbezirken verändert.
Alberti unterschied demnach die äußeren Strahlen, die die Außenfläche der Sehpyramide bilden und die dem Auge die
Größe und Form der Gegenstände übermitteln, die mittleren Strahlen, die den Körper der Pyramide bilden und „ in
der Art eines Chamäleons“ wie er sagt, die Farben der Gegenstände mitteilen und schließlich den zentralen
Strahl, den stärksten, der es ermöglicht, die Dinge mit größter Schärfe zu sehen und den Alberti „den Fürsten
der Strahlen“ nennt. Dass der Akt des Sehens sich weder auf eine mathematische Überlegung noch auf
physiologische Daten reduzieren läßt, die das scharfe zentrale und foveale Sehen auf ein 6-7 Grad begrenztes
Feld beschränken, sondern auch ein spiritueller und symbolischer Akt sein kann, hat der Maler Masacchio einige
Jahre vor Brunelleschi und Alberti mit der unerhört kühnen Bildkonzeption (unter Einblendung perspektivischer
Malerei) für das Grab des Domenico Lenzi in der Dominikanerkirche S. Maria Novella (Florenz) realisiert,
dargestellt sind die göttliche Trinität sowie die Figuren der Kreuzigung. Die Fresken Masacchios, auf die
Warburg ein Auge geworfen hat, wirken heute wie das Vermächtnis eines jungen Malers, der wenig später auf einer
Reise nach Rom mit nur sechsundzwanzig Jahren gestorben – wir schreiben das Jahr 1428 .
Im zweiten Blick auf die Renaissance offenbart sich uns Machiavellis Kalkül der Machtsicherung, das der
„Fremdheit der Menschen gegeneinander Rechnung trägt.“ In den Quellen lesen wir, dass die Kriegsfürsten der
Renaissance Geld bis an die Kamine besaßen, sie beschäftigten kleine Armeen von Schreibern und Miniaturisten, um
den materiellen und symbolischen Wert ihrer Besitztümer zu inventarisieren. Die Truppen des Frederico da
Montefeltro , Herzog von Urbino, plünderten Städte,
massakrierten die Bevölkerung und raubten Kunstschätze. Maler wie Paolo Uccello, Pedro Berruguete und vor allem
Piero della Francesca standen dem Herzog zu Diensten. Der Herzog von Urbino war mit Sicherheit einer der
reichsten Männer seiner Zeit, seine Bibliothek und seine Kunstwerke zählten zu den bedeutendsten der
Renaissance. Auf 335 000 Dukaten beziffert ein Inventar sein Vermögen, gering im Vergleich dazu war der
Reingewinn von 18 000 Dukaten des Medici-Konzerns, eines Wirtschaftsunternehmens europäischer Bedeutung. Will
man die Kunstakte der Renaissance und deren Verschränkung mit der politischen Ökonomie verstehen, muß man das
sozio-ökonomische Umfeld berücksichtigen, auch diese Wegstrecke der Spurensicherung hat Aby Warburg
zurückgelegt.
IV
Seit 1886, also seit Begin des Studiums, führte Warburg regulär Buch über seine Bücherankäufe. Mit der Zeit
vermehrten sich die Bücher wie Kaninchen. 1922 waren es bereits 15 000 Bücher, die das Fassungsvermögen von
Warburgs Wohnhaus in der Heilwigstraße 114, gelegen in Hamburgs Stadtteil Eppendorf, überstiegen . 1926 wurde schließlich am Nachbargrundstück ein
Bibliotheksneubau mit überkuppeltem ovalen Lesesaal eröffnet, der eine horizontale und eine vertikale Verzahnung
der Wissensgebiete gestattete und mit modernsten Technologien ausgestattet war. Wie eine Fahne im Wind flatterte
der griechische Schriftzug Mnemosyne in feinziselierter Gravur über dem Türsturz im Eingang der
Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. Wer denkt dabei nicht an die goldgewandete Mnemosyne, die in
Pindars 6. Isthmischer Ode majästetisch vor Augen tritt. Wenn Warburg sich in der Bibliothek in seine
Forschungen vertiefte, teilte er den Hort der Gelehrsamkeit mit der relevanten wissenschaftlichen Prominenz
seiner Zeit: In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die Modernisierung der abendländischen
Gelehrtenkultur mit Beginn der Aufklärung von den Rändern her erfolgte, denn Warburgs Bibliothek, ein hortus
conclusus, wandelte sich erst nach und nach von einer Privatbibliothek in eine öffentliche Institution .
Naturgemäß gedeihen solche Anstrengungen auf materieller Grundlage, die das Großkapital der Familie Warburg
trefflich in Szene zu setzen verstand.
Noch rechtzeitig konnte im Dezember 1933 der größte Teil der Bibliothek mit etwa 60 000 Bänden vor dem Zugriff
des Nazi-Regimes gerettet werden. Mit einem an Tollkühnheit grenzenden Mut und instinktgeleitetem Handeln
übersiedelte Fritz Saxl die Bibliotheksbestände nach London und schuf damit die institutionellen Grundlagen für
das heutige Warburg Institute, das als eigenständige Einrichtung der Universität London angegliedert ist.
Im Winter 1933 lagerten am Ufer der Themse 531 Bücherkisten, weiters die fotografische Sammlung mit 25 000
Abbildungen, samt den Regalen, Möbeln und Gerätschaften der Bibliothek. So verschieden die Lebensläufe jüdischer
Intellektueller auch verliefen, gemeinsam ist allen die politische Energie, die sie gegen den Naziterror wie ein
Schutzschild errichteten. Viele Wege führten ins Verstummen, in Verzweiflung, Entbehrung und Tod. Die
Warburg-Mitarbeiter, die aus Hamburg nach London emigrierten, blieben am Leben. Es waren das Fritz Saxl, die
wissenschaftliche Assistentin Gertrude Bing, der Bibliothekar Hans Maier, der Buchbinder Otto Fein, der
Privatdozent der Hamburger Universität Edgar Wind.
Wer ist Fritz Saxl?
Saxl wurde 1890 in Wien geboren, studierte Kunstgeschichte in Wien und Berlin und wurde 1912 mit einer Arbeit
über Rembrandt promoviert. In dieser Zeit fällt das erste Zusammentreffen mit Warburg in Hamburg. Hitzig und
leidenschaftlich erörtern die beiden Querdenker mythologische und astrologische Fragestellungen.
Saxls Forschungsgebiet war die Ikonographie der Planeten. Im Auftrag Warburgs studierte er illuminierte Kodizes
in Wien, Rom und Oxford und legte in drei Bänden ein Verzeichnis astrologischer und mythologischer Handschriften
des lateinischen Mittelalters an . Während der
Erkrankung Warburgs übernahm Saxl die Leitung der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek, er organisierte den
Ausbau und die Einbindung der Bibliothek in den universitären Betrieb der Stadt Hamburg. Saxl fungierte als
Herausgeber umfangreicher Schriftenreihen. Innerhalb nur eines Jahrzehnts, zwischen 1922 und 1933, konnten neben
Einzelpublikationen, darunter die zweibändige Ausgabe der „Gesammelten Schriften“ Warburgs, 21 Bände der Reihe
„Studien“ und jene der „Vorträge der Bibliothek Warburg“ vorgelegt werden. Unter den Verfassern finden sich –
neben dem Philosophen Ernst Cassirer und dem Kunsthistoriker Erwin Panovsky, die der Bibliothek als spiritus
rectores und Hausautoren aufs engste verbunden waren – so namhafte Gelehrte wie die Historiker Percy Ernst
Schramm, Alfred Doren und Hans Liebeschütz, die Kunsthistoriker Walter Friedlaender, Adolph Goldschmidt, Jacques
Mesnil, Gustav Pauli, Julius von Schlosser, Hubert Schrade, Wolfgang Stechow oder Hans Tietze, Altphilologen wie
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Eduard Norden und Richard Reitzenstein, Orientalisten wie Helmut Ritter,
Religionshistoriker wie Franz J. Dölger und Rudolf Eisler, Literaturhistoriker wie Karl Vossler,
Rechtshistoriker wie Conrad Borchling, Ethnologen wie Hugo Preuß und zahlreiche andere .
Man braucht nur auf die Schätze von Fritz Saxls brieflichen Äußerungen zurückgreifen, aber auch seine
publizierten Schriften zur spätantiken Archäologie, zum Mithraskult und zu indogermanischen Gottheiten
durchstreifen, um zu erkennen, dass Saxls Leistung darin bestand, das Lebenswerk Warburgs zu sichern und dessen
Umrisse der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zu vermitteln.
Saxl war der erfindungsreiche Copilot Warburgs, der von sich sagte, er sei ein Landstreicher durch die Museen,
Bibliotheken und Archive Europas. Seine „Vollblutforscherleidenschaft“ wurde von Warburg immer wieder gepriesen,
der Kosename „Saxelino“ ist in die Briefliteratur
eingegangen.
Man erkennt in Fritz Saxl einen außergewöhnlichen Menschen, der zur selbstlosen Mitarbeit fähig war und dessen
eigene wissenschaftliche Produktion zu Unrecht in den Hintergrund getreten ist hinter den Leistungen, die er für
die Bibliothek Warburg erbracht hat. Es ist zu wünschen, dass die zweibändige Ausgabe von Saxls „Lectures“, die
in den fünfziger Jahren in England erschienen ist, eine Übertragung ins Deutsche erfährt, und dass in Zukunft
noch ausstehende Materialien für eine intellektuelle Biographie Saxls erforscht und veröffentlicht werden
.
Und da ist noch etwas Bemerkenswertes: Bei Saxl ist alles vorgezeichnet, was im Hause Warburg an Bildexperimenten
gewagt wird. Die Rede ist von dem Bilder-Macher Fritz Saxl.
Saxl stand im Geschützdonner des Ersten Weltkrieges als Leutnant der Reserve an der deutsch-italienischen Front,
die Korrespondenz, die er in den Jahren 1915-1919 mit Warburg führte, zeigt auf, dass Saxl nach seiner Rückkehr
aus dem Krieg als Angestellter im Deutsch-Österreichischen Staatsamt für Heereswesen mit Volksbildungsaufgaben
betraut war. Körper- und Seelentechniken sollten die Konstitution des Militär- Proletariats verfeinern. Für die
Dressur der Volkswehrmänner installierte das Reichsbildungsamt sogenannte „Bildungsräte“: „Aus jeder Kompagnie
wird von der Mannschaft ein Bildungsrat gewählt, dieser kann Mannschaft oder Offizier sein“, notierte Saxl, und
er wertete das Rätesystem als „Versuch, Bildung von unten zu organisieren“.
Im Dienste der Deutschösterreichischen Volkswehr wird Dr. Saxl in der Kaiserstadt Wien und in der Provinz im
Jahre 1919 eine rege Ausstellungstätigkeit beginnen und mit Schwung und ästhetischem Geschick betreiben. Es ist
ein Gang ins Grobe, ungebildete Volk, den der Intellektuelle hier zu beschreiten beginnt. Die Anstiftung der
Unterschichten zur Bildung treibt seltsame Blüten, so verfaßt Saxl im Jahre 1919 den Aufsatz: „Das Proletariat
und die bildende Kunst“ und er tourt mit Wanderausstellungen durch österreichische Ländereien. Begeistert
berichtet er Warburg im Brief vom 15.7.1919 von einundzwanzig Ausstellungen, die bereits ausgearbeitet waren so
wie weitere fünf, die noch in Planung waren: „(...) Ich organisiere, Was? Alles mögliche. Erstens Ausstellungen.
Ich habe den Ausstellungs-Koller, wie meine Frau sagt. Jetzt habe ich in einer niederösterreichischen kleinen
Provinzstadt eine mit dem Titel gemacht: Gartenstädte, Kleinwohnungen und Wandschmuck. Sehr hübsche Bilder aus
englischen und deutschen Gartenstädten, billige anständige Möbel, Steindrucke u.s.w. Außerdem bekommt man in der
Ausstellung auch noch billige gute Bücher zu kaufen. So versuch ich ganz kleine Kulturzellen zu verpflanzen
(...)“ Im Schluß des Briefes heißt es: „Lieber Herr Professor, ich habe Ihnen all den Unsinn geschrieben, um Sie
ein bissel zu unterhalten, werden Sie bitte recht rasch gesund, dann schreiben Sie mir gleich, ich nehme mir
Urlaub und komme zu Ihnen auf Besuch. Viele viele herzliche Grüsse und Wünsche von Ihrem alten Saxl.“
Man beachte den charmanten Wiener Dialekt: „bissel“ statt bißchen steht geschrieben, es scheint ganz so, als habe
in der bürgerstolzen Stadt Hamburg im Hause Warburg der Wiener Dialekt eine nicht ganz so geringe Rolle
gespielt. Man beachte ferner, dass Warburg ein Wiener Warburg Institut andachte und des öfteren ein Briefpapier
verwendete, hergestellt in Wien. Man beachte schließlich, dass Saxl die Dampfküche des Volkes sobald als möglich
verließ, um wieder in die Salonluft zu gelangen.
Ein Blick in die moderne europäische Kunst macht deutlich, dass Saxls pädagogischer Eros nicht isoliert agiert.
Bei allen formalästhetischen Pirouetten, die die Moderne auszubilden versuchte, ist dieser auch ein Hang zu
messianischen Botschaften eingeschrieben. Man denke nur an die zahlreichen Manifeste der Expressionisten,
Dadaisten , Futuristen, Surrealisten und so fort. Da ist Schönbergs Musikodex „Harmonielehre“ aus dem Jahre
1911, der zeitgleich mit Kandinskys Schrift „Über das Geistige in der Kunst“ erscheint, man beachte Paul Klees
Dozentur am Weimarer Bauhaus, die 1925 in das legendäre „Pädagogische Skizzenbuch“ mündete.
Maxim Gorkis Arbeiterepos „Die Mutter“ entstand 1906 und wurde 1926 von Vsevolod Pudovkin verfilmt; in dem Film
„Panzerkreuzer Potemkin“ (1926) ist es die Wahrheit der geballten Proletarierfaust, die Eisenstein auf der
Leinwand installierte; das Subjektwerden der Massen geriet bei Vsevolod Mejerhold zum großen Massenschauspiel,
mit Maschinengewehren bewaffnete Männer und Frauen sangen im Jahre 1920 unter Moskaus Himmel vom „Reich des
Friedens“ und zum Zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale führten 4 000 exzentrische Akteure in
pathetischen Bildern die Geschichte der Arbeiterbewegung von 1848 bis zur Russischen Revolution auf .
Zahmer, zivilisierter ging es in Wien zu: Hier begann die Volksbildung um 1900 mit der Errichtung von Volksheimen
zu wuchern, erwähnt sei die erste Volkshochschule Wiens, situiert in Ottakring, in der Fritz Saxl 1919 die
antifaschistische Ausstellung „ Das Joch des Krieges. Eine Bilder-Ausstellung“ präsentierte. Theater- und
Kinoaufführungen, Ausstellungen gefolgt von Vorträgen sowie Büchereien waren das buntscheckige Programm, das die
Unterschichten zu mobilisieren hoffte, so leitete 1923 der Zwölftonmusiker Anton von Webern den
Sozialdemokratischen Singverein, 1928 feierte er als Dirigent umgeben von Arbeiterchören „60 Jahre Lied der
Arbeit“.
Allen diesen großen und kleinen, leisen und lauten Ereignissen ist die Tendenz inne, eine proletarische
Öffentlichkeit im Gegensatz zur bürgerlichen auszubilden. Was daraus geworden ist, sehen wir daran, dass die
wilde Kultur der Unterschichten zur kleinbürgerlichen Kultur geschrumpft ist.
V
In der Welt Warburgs sind politischer und persönlicher Wahnsinn untrennbar verquickt. Die Texte und
Bildersammlungen, die Warburg produzierte, erzählen von den Gefährdungen und Grenzen phantasiebegabter
Sensibilität. Familiäre und finanzielle Dissonanzen und das Gewaltsame des Ersten Weltkrieges dürften eine
seelische Dämmerung hervorgerufen haben. Von 1918 an befand sich Aby Warburg in psychiatrischer
Behandlung, zwischen Mai 1921 und August 1924 war
Warburg Insasse im Privatsanatorium „Bellevue“. Die Klinik in Kreuzlingen am Bodensee wurde von dem renommierten
Schweizer Psychiater Ludwig Binswanger geleitet, dessen Nachlass und das „Bellevue-Archiv“ werden im
Universitätsarchiv Tübingen verwahrt. Siebzig Jahre nach Tod Warburgs stehen diese Archive nicht mehr unter
Benutzerbann und so geschah es, dass die Krankenakte Warburg von der Hand Binswangers sowie die Aufzeichnungen
der Pfleger und die Protokolle Fritz Saxls ausgewertet wurden .
Zunächst täglich, dann in größeren Abständen dokumentierte Binswanger den Zustand des Patienten. Binswanger
beschreibt Warburgs Wahnvorstellungen, die latente Aggressivität gegen die eigene Person und das Wärterpersonal,
Phobien und zwanghafte Hygienerituale.
Warburgs Körper kann nicht stillhalten, er ist triebhaft, er stampft, schreit und wütet, nachts und morgens
lamentiert er laut, hält Selbstgespräche oder redet mit sogenannten „Seelentierchen“. Seine Erregung wird mit
der Eingabe von Opiumtropfen, mit strikter Bettruhe und Dauerbädern eingedämmt. Anzeichen einer Besserung sind
kaum wahrnehmbar, so wird der Psychiater Emil Kraepelin zu Rate gezogen, der am 6. Februar 1923 die Diagnose
Binswangers, lautend auf Schizophrenie, in manisch-depressiven Mischzustand umschrieb. Was für eine Krankheit im
diagnostisch genauen Sinn das war, tut wenig zur Sache. Tatsache ist, dass den Wahnsinn als tragische
Grenzerfahrung viele schöpferische Menschen erfahren haben. Man denke an die Schmerzensmänner Friedrich
Hölderlin, Vincent Van Gogh, Antonin Artaud, Ernst
Ludwig Kirchner, Nikolaus Lenau - sie alle und viele Unbekannte mehr waren Traumwandler und Hellsichtige am
Rande des Abgrundes, schon Plotin deutete den Zustand der Existenz als ein Umschattet-Umdunkelt werden.
Wenn man sich an Warburgs bittere Zeit in Kreuzlingen erinnern will, sollte man an ein Schneebild denken: Auf
einem Lichtbild, datiert mit Jänner 1922, sind Aby Warburg und seine Frau Mary auf einem Spaziergang im
tiefverschneiten Park des Sanatoriums „Bellevue“ zu erkennen. „Weiß ist wie ein Murmeln, Flüstern, Beten“,
bemerkte Robert Walser. Walser, der arme, schüchterne Dichter, der „knabenhaft“ zu schreiben wünschte, wird im
Schnee an Weihnachten 1956 im Garten der Irrenanstalt Herisau sterben. Dem Patienten „Nr. 3561“, 23 Jahre
interniert, „ziemt es, möglichst unauffällig zu verschwinden“.
Und weil die Ohnmacht ein Gefühl von Stärke leiht, begann Warburg die Verzweiflungsdisteln auszujäten. Vielleicht
war es einfach so, dass er sich an Platons Lehre von der Dreiteilung der Seele in Vernunft, Mut und Begierde
erinnerte. Mit Vernunft bestritt Warburg am 21. April 1923 vor seinen Mitpatienten in der Anstalt „Bellevue“
einen Vortrag über das „ Schlangenritual der Hopi-Indianer“, mit Mut entfloh er den psychiatrischen Instanzen und mit Begierde
widmete er sich zentralen kognitiven Funktionen wie Denken, Gedächtnis und Wahrnehmung. Auch die Bibliothek, das
Haus der Mnemosyne, in das Warburg 1924 zurückkehrte kann für ihn ein Ort der Genesung gewesen sein. Mit
Paukenschlag konzipierte die architektonische Endfassung der Bibliothek nach Plänen von Gerhard Langmaack und begann mit der genialen Bastelei
an einem Bilderatlas zum Nachleben der Antike, genannt „Mnemosyne-Atlas“.
VI
Der „Mnemosyne-Atlas“ ist zweifelsohne einer der bemerkenswertesten und intelligentesten Bildkompendien zum
Nachleben der Antike.
Konstruiert mit 1180 Fotografien setzt sich der „Atlas“ in seiner letzten Fassung aus 63 Tafeln zusammen. Die von
Warburg ausgewählten Bilder beziehen sich vor allem auf das Nachleben der Antike und zeigen Reproduktionen von
Skulpturen, Reliefs, Grisaillen, Fresken, Friesen, Teppichen, Malereien, Zeichnungen, faksimilisierten
Buchseiten, Reklamezetteln und Zeitungsausschnitten. Dort wo das akademische Denken nicht hinreicht, hilft die
Illustration, das was im Dunkel der Gelehrtenstube zu versickern droht, muß in ein Medium verwandelt werden, das
der Massenkommunikation entspricht.
Warburg tut dies mit Hilfe der Bildmittel, die er am Beginn des 20.Jahrhunderts erwirbt. Dieses Medium im
Zeitalter der Moderne ist die Fotografie. Alles, was wir über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit schon immer wissen wollten, hat der Kunsttheoretiker Walter Benjamin vor etwa siebzig Jahren
niedergeschrieben. Die Fotografie spricht im historischen Perfekt: Die Welt ist stillgehalten, die Melancholie
der Vanitas wird verscheucht. Unter den Bilderfindungen in Malerei und Fotografie ist das Stillleben von
jeglicher Bewegung befreit und Warburgs fotografische Papierberge weisen in die nature morte, sein Bilderatlas
zeigt sowohl den Vorgang des Absterbens des Lebendigen als auch die Beseelung und die Verlebendigung des Toten.
Manchmal ist die Blutspur des Abendlands sogar sichtbar.
Warburgs vergleichende Kulturwissenschaft untersucht parallel zirkulierende und vagabundierende Kulturen. Was wir
sehen, ist ein furios montiertes Bilder-Konvolut zwischen Spurensicherung der europäisch-orientalischen
Bildersprache und Bildgedächtnis der Moderne. Warburg kartographiert im „Atlas“ die Wanderstrassen antiker
Kulturen von Athen nach Alexandria und Indien und von dort rückwandernd über Persien und das muslimische Spanien
nach dem mittelalterlichen Europa und bis in die Kunst des florentinischen Quattrocento zu Botticelli,
Ghirlandaio, Filippino Lippi, Mantegna, Piero della Francesca und bis in die Epoche des Barock. Warburgs
kulturgeschichtliches Panorama ist reich gestuft, zumal in Hinweisen auf Parallel- und Folgephänomene wie sie
uns in Bildern moderner alltäglicher Massenmedien vor Augen treten.
Der „Atlas“ empfing seine Nahrung auch aus der geographischen und kosmischen Position, in die Warburg
aufgebrochen war: Rom, Florenz und Neapel sind die
Städte des Begehrens und auch das Brackwasser der Alster haben am Atlas mitgewirkt. Joris-Karl Huysmans
Städteporträt über Hamburg charakterisierte das Venedig des Nordens in prägnanter Weise. Man muß diesen Text
langsam lesen, damit die farbigen Genreszenen der Speicherstadt am Ausgang des neunzehnten Jahrhunderts auf der
Netzhaut explodieren können.
Kann man sagen, dass sich die atmosphärischen Nuancen der Meeresluft im Schwarzweiß des „Atlas“ spiegeln?
Wir unterscheiden vier Fassungen des „Mnemosyne-Atlas“, an dem Warburg, Fritz Saxl, Gertrude Bing und Lothar
Freund seit 1924 gearbeitet haben. Eine auf den 15.Mai 1928 datierte Fotoserie von 43 Tafeln, eine andere aus
dem Jahre 1929 mit 19 Tafeln, die Warburg in der Bibliothek Hertziana in Rom vorstellte. In Hamburg erstellte er
eine „vorletzte Serie“ mit 68 Tafeln plus einer vereinzelten Tafel 77, noch im gleichen Jahr entstand die
„letzte Serie“, die 79 Tafeln haben sollte, von denen aber nur 63 Tafeln mit 1180 Objekten fertiggestellt worden
sind .
Allen diesen Fassungen ist der provisorische Charakter der jeweiligen Bildmontagen eingeschrieben, der „Atlas“
bleibt bei Warburgs Tod am 26. Oktober 1929 ein gewaltiger Papiersteinbruch, für den Warburg nie einen
endgültigen Titel zu finden vermochte.
Die Durcharbeitung der Tafeln in immer neuen Motiven erfolgte in skizzenhafter Raschheit. Alles wird immer
ausgetauscht, alles ist zum Austausch vorgesehen. Warburg bereitet vorsichtig, aber hartnäckig sein Material
aus. Rund 2 000 Abbildungen von Kunstwerken sind das Bildreservoir, aus dem er immer neue Konfigurationen zu
bilden vermochte.
Es ist entscheidend wie Warburg die Bildchen auf den Tafeln montierte, innerbildliche Kriterien wie Maß und
Symmetrie, Form und Stellung ergeben ein ästhetisches Koordinatensystem. Wie ein Stoffgewebe aus Ketten und
Einschlagfäden, so besteht der Atlas aus horizontalen und vertikalen Linien. Die Bilder scheinen wie mit Nadel
und Zwirn in die Fläche gestickt. Der langsame oder schnelle Pulsschlag der schwarz-weißen Fotostrecken wirkt
melodiös. Ein ästhetisches Arrangement der Zwiesprache hält die Motivreihen zusammen, determiniert ihre
Nachbarschaft, Motive prallen aufeinander, beruhigen sich, kehren wieder, entfernen sich, ohne größere Ordnung
als die eines Mückenschwarms. Der „Atlas“ wird über weite Strecken zu einem Seherlebnis, das Geist, Emotion und
Empfindungen zu gleichen Teilen anregt.
Den „Atlas“ erkennt man an seiner handwerklichen Machart. Er riecht nach feinem Gedankenleim, rohen Holzgestellen
und schwarzen Tuchbahnen. Wenn die Hand Warburgs das schwarze Tuch berührt, gibt es nur noch Unterschiede des
Druckes, der Geschwindigkeit, des Winkels und der Richtung. Denn die Kunst ist ja nichts anderes als die
Stofflichkeit der Mittel um Ausdruck herauszuholen. Die künstlerische und die intellektuelle Praxis ist immer an
den Körper, an dessen erotische Dimension, also von der Hand hervorgebrachte Bilder.
Warburg ist jemand, der von Anfang an Sehen, Anordnen, Begreifen als eine Tateinheit verstanden hat. An die
Stelle eines doktrinären Stils und einer festen Theorie tritt eine Kunst der Möglichkeiten, die das Spiel mit
dem Fragment, mit dem Reiz des Unfertigen und Kombinatorischen einschließt. Der Bilderatlas ist buchstäblich ein
avantgardistisches Werk .
Dem Kunsthistoriker Günter Metken verdanken wir einen geistreichen Hinweis auf das musikalische Koordinatensystem
im „Atlas“: „Stellenweise erinnert der Atlas an Fotomontage und Film, deren Siegeszug Warburg ja als Zeitgenosse
miterlebte. Was Warburg da auf Reisen, in Hotelzimmern schuf, die Bilder beschneidend, umordnend, war in
Wirklichkeit Kunst; visuelle Sequenzen, Rhythmen, die einen in Schwung versetzen, gleichsam tänzerisch
überwältigen, wobei die Argumentation manchmal forciert, ihre Schlüssigkeit dem Linienfluß untergeordnet wird:
Ikonographische Weissagung aus dem Geist der Musik“.
Hinzuzufügen wäre, dass der „Atlas“ Stimmungen im starken, Schumannschen Sinn inkludiert. Eine Abfolge
widersprüchlichster Aufwallungen wird sichtbar: Denkpausen durchaus nicht ohne Humor, Wellen der Angst,
Ausmalungen des Schlimmsten wechseln mit Euphorien - die Musik Haydns mit den schönen feurigsten Symphonien ist
jedoch in weite Ferne gerückt.
Mit unendlicher Geduld für das Detail und in einer die Wörter sorgfältig abschmeckenden Sprache, bringt Warburg
nach und nach Notizgruppen zu Papier, die die kontrapunktische Dimension des „Atlas“ bezeichnen sollen. Ein Bündel fließender und stockender Schreibströme
kennzeichnet die Aufzeichnungen. Es sind Gedankensplitter so erratisch wie Aphorismen von Nietzsche oder
Gedichtfetzen des späten Hölderlin. Wie die moderne Literatur den Satzabschluß zu sprengen versucht (Coup de dés
Mallarmes), extreme Wucherung des Proustschen Satzes, Zerstörung des typographischen Satzes in der modernen
Lyrik oder wie die moderne Musik bei Schönberg, Berg und Webern das Aas am Notenschlüssel verankerte, so zittert
Warburgs Schreiblust-Schreibangst wie eine Kompassnadel auf sturmgepeitschter See.
Schon nach der Botticelli Dissertation geriet Warburg in eine Schreibhemmung, die bis zu seinem Tod anhalten
sollte, sodaß Warburg kein Hauptwerk hinterließ, sondern gerade einmal knapp 350 veröffentlichte Seiten, dazu
viele Vorträge und Manuskripte, die inzwischen publiziert vorliegen.
Wie in Atlanten auf Vulkankarten die Angabe glühend heißer Zonen fasziniert, so tauchen auf den Atlastafeln
fiebrige und vibrierende Bilder auf. Dominante Gefühle und Empfindungen des homo sapiens seit Adam und Eva sind
im „Atlas“ eingekapselt. Angst und Lust, Schmerz, Ohnmacht, Ekstase, der gellende Wahnsinn. Was primär in Rede
steht, ist der fundamentale Schmerz (poine, ponos). Was aus der Antike emporsteigt, ist die Wehklage, der
Schrei. Diesen Ereignissen verleiht die griechische Kunst eine Form, die nicht abgestimmt ist auf die Harmonien
der apollinischen Lyra sondern auf die Maßlosigkeit des dionysischen Schreis.
Warburg schlägt sich wiederholt ins Dickicht der antiken Religions-, Vegetations- und Fruchtbarkeitskulte,
vorzugsweise umzingelt er orgiastische Massenkulte Kleinasiens wie sie uns in der Gestalt des Dionysos-Kultes und seiner Gefolgschaft,
der Mänaden, vor Augen trten. Im Haar Lorbeer und Schlangen schwingen die Mänaden den Thyrsos, einen mit
Tannenzapfen an der Spitze geschmückten, mit Efeu umwundenen Stab, der auch als Waffe dient. Bei den
orgiastischen Massentreffen und ihren heiligen Handlungen, die alle zwei Jahre zu Ehren des Gottes Dionysos auf
dem schneeigen Kithairon-Gebirge stattfinden, zerreissen die im thiasotischen Taumel erfaßten Frauen Tiere und
Menschen, verzehren deren rohes Fleisch und plündern in Städten. Atemberaubend erzählt der griechische Dichter
Euripides in den „Bakchen“ vom Dionysoskult, der Züge einer Kultur des Wahnsinns und Deliriums trägt. Immer
wieder läßt Warburg Bildschöpfungen der Mänade im „Atlas“ auftreten, als gelte es der Kopfjägerei Einhalt zu
gebieten und das Ideal der Sophrosyne aufzurichten, d.h. die faktische Kontrolle und Selbstbeherrschung des
Subjekts. Es sind die Pathosgestalten der Antike- wie die Mänade oder der von den Frauen zerstückelte
Orpheus, die im Schlingwerk des „Atlas“ immer wieder
in Metamorphosen auftreten.
Den ovidianischen Märchen hat der Warburgkreis viele Studien und eine Ausstellung gewidmet, da die Metamorphosen
„den Menschen in die Hyle zurückwandeln, den raptus ad inferos versinnbildlichen.“
Mit Warburg taucht ein Bildhistoriker am Horizont des 20. Jahrhunderts auf, der die Verwandlungen,
Abschwächungen, Verpuppungen und Verdrängungen der fortwirkenden Formeln der Antike freilegte. Warburg
rekonstruierte Spuren antiker Pathosformeln, destillierte wiederkehrende Strukturen und sezierte Konstanten des
Ausdrucks als eine Art Menschheitspsychologie. Einmal beschrieb Warburg den Zweck seiner Zusammenarbeit mit dem
Philosophen Ernst Cassirer in einem Brief an diesen, in dem er sagte, „dass wir beide eine allgemeine
Kulturwissenschaft als Lehre vom bewegten Menschen schaffen werden“. Warburg, der in der Antike, die in
erhabener Tragik stilisierte Form für Grenzwerte mimischen und physiognomischen Ausdrucks fand, charakterisierte
die Pathosformeln als die „Superlative der Gebärdensprache“. Vom lebendigen Leib ausgedrückt, verflüchtigen
Gebärden, aber in einem Bild dargestellt, sind sie über lange Zeit kopierbar und somit eine Formel .
Dem Destillator der in der Literatur viel zitierten Pathosformel ist das Pathos der Vollendung versagt geblieben,
und dennoch: Der Fragment gebliebene „Atlas“ glitzert als roter Rubin im Diadem der Moderne; müßig
festzustellen, dass der „Mnemosyne-Atlas“ Wahlverwandtschaften zu Walter Benjamins grandiosem „Passagenwerk“
(1927-1940) aufweist . Benjamin, Adorno, Warburg haben
die typischen Ästhetiken des 20. Jahrhunderts geschrieben, da in ihrem Fragmentarismus die Bruchlinien der
aktuellen Avantgarden aufblitzen. Der spröde Konservatismus Warburgs steht gegen die linke Prophetie Benjamins
und gegen die Melancholie Adornos .
Mit Winckelmanns Appell „Wir müssen die Griechen nachahmen!“ begann die deutsche Kunstgeschichte im achtzehnten
Jahrhundert ihre Flugbahn, denn mit den „Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums“ , verfaßt im
Jahre 1767, hat Johann Joachim Winckelmann ein neues akademisches Fach erfunden: Die Kunstgeschichte. Wie der ungeheure Erfolg Winckelmanns in seiner Zeit
darauf beruhte, dass er neue Verhaltensweisen zu Kunstwerken lehrte: eine totale Sensibilisierung wie wir heute
sagen würden, so formulierte Warburg im Blick auf Jacob Burghardts kulturtheoretische Schriften eine
interdisziplinäre Lesart des klassischen Altertums und seiner Formschicksale.
VII
Unter den bislang vierzig Daedalus Ausstellungen war im Jahre 1993 eine Schau dem Spätwerk Aby Warburgs gewidmet.
Das Zusammenspiel der Bildersammlung von Sternglaube und Sternkunde mit dem Bilderatlas „Mnemosyne“ wurde
sichtbar gemacht. Mit dem Ziel den „Mnemosyne-Atlas“ zu rekonstruieren, begann eine Sisyphos-Arbeit von
ungeahnter Dimension. Allein die Legendierung der 1180 Bildmotive wie auch die Beschaffung der Bildformen aus
Zeitungsfotos und Reproduktionen von Kunstwerken dauerten über ein Jahr lang und beschäftigten ein Rudel von
Wiener Kunstwissenschaftlern. Schließlich ging es um nichts Geringeres als um eine maßstabsgetreue
Rekonstruktion der verlorengegangenen „Atlas-Tafeln“, diese konnten mit Hilfe alter Fotografien, die im Warburg
Institute in London vorrätig sind, identifiziert werden. Somit konnte der Bilderatlas in seiner letzten Fassung
mit 63 Tafeln in einer Rekonstruktion erstmals im Jahre 1993 in Wien zur Darstellung gelangen.
Der Schauplatz der Warburg Schau war die Aula der Akademie der bildenden Künstler, für die das Künstlerpaar Anne
und Patrick Poirier und der Architekt Thomas Kierlinger eine opulente Ausstattung entwarfen.
Das aufgeschnittene Modell des Bibliotheksbau stellten die Poiriers in eine Ellipse, welche die ovale Leseform
des Hamburger Lesesaals aufgriff. Die hintere Ellipsenwand war mit Notizblättern Warburgs aus dem Nachlass
gespickt; die astrologische Bilder-Sammlung lief linear auf das schreinartige herausgehobene Bibliotheksmodell
als das Haus der Mnemosyne zu, das nach beiden Seiten in einen weißen Kreuzgang mit Studierzellen für die
einzelnen Tafeln des „Mnemosyne-Atlas“ ausstrahlte .
VIII
Wir erkennen, dass in der Gegenwart die Antike große Beachtung erfährt .
So eröffnete im April das Metropolitan Museum in New York seinen noblen Antiken-Flügel. Tausende Objekte, die
bisher in den Magazinen schlummerten, erblickten das Licht der Öffentlichkeit; die Freude ist groß über den
Abschluß eines Großprojektes, das Anfang der neunziger Jahre in Angriff genommen wurde und 220 Mio. Dollar
verschlang. Der Louvre hat zuletzt eine ausschweifende Praxiteles Ausstellung eingerichtet, nicht unfern vom
Louvre, in der Bibliothèque Nationale wurden illuminierte Kodizes zu Homers „Odyssee“ und „Ilias“ aufgeblättert
und die Documenta wollte uns Glauben machen, daß die Moderne unsere Antike sei.
Eine weitere Lesart des „Mnemosyne-Atlas“ erfolgte 2007 im Musensaal der Albertina unter Berücksichtigung des
aktuellsten Forschungsstandes in asketischer Formgebung , der pluridisziplinäre Charakter des Unternehmens ist
unverkennbar. Diese Ausstellung ist kein Gesellen- sondern ein Meisterstück. Es handelt sich um ein wenig
Verführung, Verführung zu einem mediterranen Effekt, der den alteuropäischen Kulturen innewohnt. Hier treffen
Licht, Himmel und Erde unnachahmlich aufeinander. Das Azurblau des Himmels, das Smaragdgrün des Meeres, die
Terra Rossa. Das sind Bilder unserer europäischen Identität.
EPILOG
Viele Sommer verbrachte Mandelstamm seit 1915 auf der Halbinsel Krim, als mittelloser
Gast, manchmal als
umherstreifender Vagabund. Hier imaginiert er den Mittelmeerraum und die antiken Griechen. Paul Celan erwarb im
Mai 1957 die gesammelten Werke von Mandelstamm im russischen Original. Ein Gedicht aus dem Jahre 1905 in der
Übertragung ins Deutsche von Celan lautet:
Schlaflosigkeit. Homer. Die Segel, die sich strecken.
Ich las im Schiffsverzeichnis, ich las, ich kam nicht weit:
Der Strich der Kraniche, der Zug der jungen Hecke
Hoch über Hellas, einst, vor Zeit und Aberzeit.
Wie jener Kranichkeil, in Fremdestes getrieben-
Die Köpfe, kaiserlich, der Gotteschaum drauf, feucht-
Ihr schwebt, ihr schwimmt-wohin? Wär nicht drüben,
Achäer, solch ein Troja, ich frag, was gält es euch?
Homer, die Meere, beides: die Liebe, sie bewegt es.
Wem lausch ich und wen hör ich? Sieh da, er schweigt, Homer.
Das Meer, das schwarz beredte, an dieses Ufer schlägt es,
zu Häupten hör ichs tosen, es fand den Weg hierher.
Wien im November 2007
Abschrift des handschriftlichen Manuskripts: Lea Alice Bernhard
Dieser Text wurde in gekürzter Form anläßlich der Ausstellungsöffnung „Aby Warburg. Der
Bilderatlas Mnemosyne“ am
22. November 2007 im Musensaal der Albertina von Gerhard Fischer vom Blatt gelesen
ABY WARBURG — MNEMOSYNE-ATLAS
61 Bildtafeln in der von Daedalus rekonstruierten Fassung von
1993. Insgesamt umfasst der Fragment gebliebene Atlas in seiner
letzten Fassung 1100 Bildformen. Die Fotografien zeigen die Aufstellung des Atlas im Albertina Museum im Jahr
2007/2008.
Fotos: Gerhard Fischer.






Mnemosyne Atlas, Tafel 39 zeigt Reproduktionen von Botticellis
Gemälde Geburt der Venus und Allegorie des Frühlings
(Primavera).
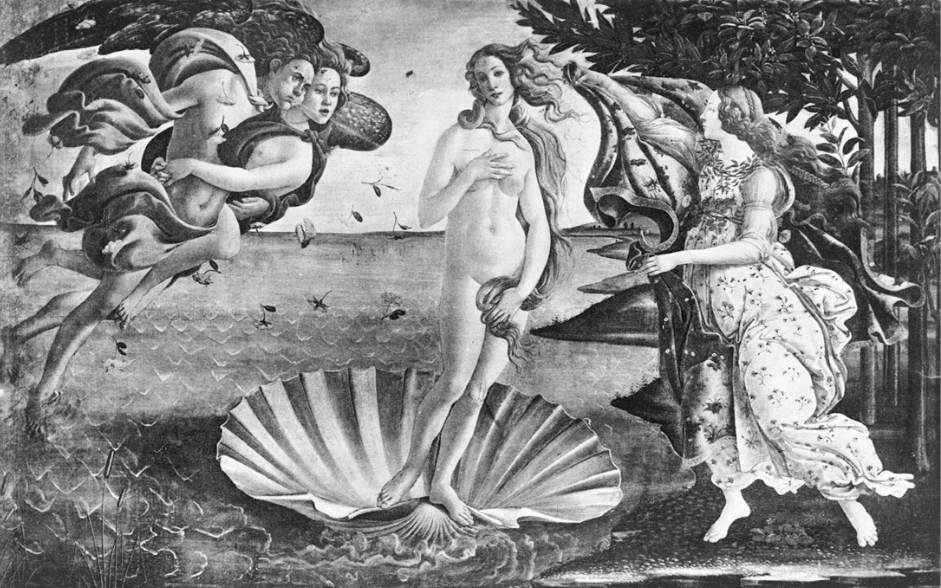
Mnemosyne Atlas, Tafel 39, Detail
Sandro Botticelli — Geburt der Venus — 1484–1486. Uffizien
Das Mädchen im Arm des Windgottes Zephyr am linken Bildrand
des Gemäldes „Geburt der Venus“ kann Iris sein , die
in der griechischen Mythologie den Beinamen „Goldgeflügelte“
trägt, mit Zephyr soll sie einen Sohn gezeugt haben, den Eros.
Auch Chloris, Anemona oder Aura wurde vorgeschlagen. Im Griechischen bedeutet „aura“ „Lufthauch“. Ein Hauch
entfährt dem
Mund des Mädchens, ein goldener Schimmer überzieht die Flügel,
den Rand der Muschel, die Haare der Venus, das Gras am Ufer
und die Blätter der Bäume.

Mnemosyne Atlas, Tafel 39, Detail
Sandro Botticelli — Primavera — 1482. Uffizien
Die botanische Vielfalt mit 500 verschiedenen Pflanzenarten in
„Primavera“ hat Mirella Levi d‘Ancona vorzüglich analysiert:
„Botticelli‘s Primavera. A botanical interpretation including
astrology, alchemy, and the Medici“, Florenz 1983. Am rechten Bildrand von „Primavera“streckt der Luftgott
Zephyr die
Arme nach der fliehenden Nympfe Chloris aus, seinen Lippen
entströmt ein Luftstrahl. Während der lustvollen Vereinigung
quellen Blumen aus dem Mund der Nympfe. Die erotische Fata
Morgana geht zurück auf die „Fasti“ des Ovid.